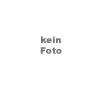Steinheim - Homo heidelbergensis (steinheimensis)
| FUND | FUNDORT | ALTER | ENTDECKER | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| adultes feminines Cranium | Kiesgrube Sigrist, Steinheim, Deutschland | ca. 250.000 Jahre | Karl Sigrist, Jr | 24. Juli 1933 |
| VERÖFFENTLICHUNG | ||||
| Berckheimer, F., 1933. Ein Menschen-Schädel aus den diluvialen Schottern von Steinheim a. d. Murr.Anthropol. Anz. 10: 318-321 | ||||
In dem weiten Tal zwischen Steinheim und dem nahen, flussabwärts gelegenen Murr wurden bis über die Mitte des letzten Jahrhunderts hinaus fossilienreiche Kiese und Sande abgebaut, die während des Eiszeitalters in Jahrtausenden und Aberjahrtausenden von Murr und Bottwar angefrachtet worden waren. Als ein erster aufsehenerregender Fund konnte im Sommer 1910 das nahezu vollständig überlieferte Skelett eines großwüchsigen Steppenelefanten, einer Elephas primigenius fraasi benannten Vorläuferform des allbekannten Mammuts, geborgen werden, und gleichen Jahres noch kam das Skelett eines Auerochsen oder Ures zutage, dem 1925 ein solches des Steppenwisents folgte.
Besonders reich war der Fundanfall dank steter Überwachung der Steinheimer Kiesgruben durch Professor Dr. Fritz Berckheimer von der Württembergischen Naturaliensammlung zu Stuttgart in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen. Davon zeugt eine Vielzahl einzigartiger Funde: Schädel sowie Gebiss- und Skelettreste vom Wald- und Steppenelefanten, vom Wald- und Steppennashorn, vom Wald- und Steppenriesenhirsch, vom Wasserbüffel und Auerochsen, vom Waldwisent und Steppenbison sowie manch anderem jagdbaren Wild neben Raubtieren wie Löwe und Säbelzahnkatze.
Weltweite Beachtung als Fossilienfundstätte fand Steinheim an der Murr aber erst durch den am 24. Juli 1933 von Karl Sigrist in den Waldelefanten-Sanden der väterlichen Kiesgrube entdeckten und anderntags von Oberpräparator Böck sorgsam geborgenen Schädel eines Urmenschen. Dieser steht trotz seines hohen geologischen Alters von zumindest einer Viertelmillion Jahren, soweit beurteilbar, dem heutigen Menschen ungleich näher als dem Neandertaler.
Unter den Funden des mittleren Pleistozäns besitzt der Schädel von Steinheim ein eigenartiges Mosaik primitiver und fortgeschrittener Merkmale, nach Größe und Morphologie zu urteilen handelt es sich um einen weiblichen Schädel. Ihm fehlen zwar die robusten Eigenschaften, wie man sie von anderen heidelbergensis-Funden kennt (Arago XXI, Petralona 1), aber ein Neandertaler im strengen Sinne ist er auch nicht.
Im Vergleich zu dem Schädel Petralona 1 mit seinem neandertalerähnlichen Gesicht und dem primitiven Hinterkopf zeigt das Stück von Steinheim genau die umgekehrte Verteilung: Neandertalerartige Merkmale findet man nur auf der Rückseite des Schädels; so besitzt er die Fossa suprainiaca, eine Vertiefung des Hinterhauptbeines. Zu Recht darf er deshalb als ein nach Zeitstellung wie Formgebung gut abgrenzbares, wichtiges Glied unter den europäischen Vorzeitmenschen betrachtet werden: dem sogenannten Homo heidelbergensis des älteren Pleistozäns nachfolgend, dem jung-pleistozänen Homo sapiens vorangehend.
Man kann in Steinheim zwar einen plausiblen Vorfahren der Neandertaler sehen - deshalb haben sich viele Fachleute entschlossen, ihn als Homo heidelbergensis einzuordnen -, aber in einigen Eigenschaften lässt er unsere eigene Spezies vorausahnen. Auch primitive Eigenschaften sind noch vorhanden, so der ausgeprägte Überaugenwulst und ein Schädelvolumen von rund 1100 cm³. Der Steinheim-Mensch hatte im übrigen ein kleineres Gehirn als sein ungefährer Zeitgenosse, der Teilschädel aus dem englischen Swanscombe, denn 1100 cm³ sind für einen Neandertaler ein recht geringes Gehirnvolumen.
In manchen Merkmalen des Gesichts und vielleicht auch in der Abwinkelung der Schädelbasis ähnelt der Fund von Steinheim allerdings eher dem Homo sapiens als dem Homo neanderthalensis. Das Gesicht wurde nach dem Tod zwar durch Verformungen und Verschiebungen entstellt, aber es erscheint eindeutig flacher als bei den Neandertalern und besitzt neben der Nasenöffung eine geringfügige Vertiefung, die man bei den Neandertalern nicht findet. Weitere moderne Merkmale sind die große Stirnhöhle, die geraden, umfangreichen Scheitelbeine und die kleinen dritten Molaren. An dem runden Warzenfortsatz unten am Schädel unter den Gehörgängen fehlen die ausgeprägten Knochenleisten, die man dort bei den Neandertalern mit ihren großen Beißkräften findet. Im Zusammenhang mit diesem Schädel wurden weder andere Skelettteile noch Steinwerkzeuge gefunden, die weitere Aufschlüsse über seine Artzugehörigkeit geliefert hätten.
Die stammesgeschichtliche Bedeutung des Fundes aufzuhellen, ist das eine, das andere aber ist das individuelle Schicksal der Steinheimerin zu ergründen, die offensichtlich auf gewaltsame Art bereits in jungen Jahren ums Leben kam. Ihr Kopf wurde abgetrennt, die Schädelbasis aufgebrochen, und dies macht nur Sinn, wenn man nach dem Gehirn trachtet. Damit aber deutet sich ein frühes Auftreten kultischer Anthropophagie an, die einst im Mündungsgebiet der Bottwar in die Murr von Menschen ausgeübt worden war, denen ein Sprechvermögen und die Fähigkeit zu einer artikulierten Sprache zu eigen war.