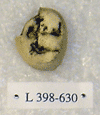Charles Darwin und die Anfänge der Evolutionstheorie
Der Vorstoß der Geologen und Paläontologen in die Vergangenheit wurde von einem enormen Erkenntniszuwachs der Ärzte und Biologen begleitet. So veröffentlichte der Engländer Edward Tyson im Jahr 1699 die erste wirklichkeitsnahe Abhandlung über die vergleichende Anatomie von Mensch und Schimpanse: Die auffällige Verwandtschaft ließ sich nicht länger verheimlichen.
Der französische Philosoph Rene Descartes (1596 bis 1650) ahnte den Angriff auf die Sonderstellung des Menschen, als er in einem mechanistischen Universum einzig dem Menschen eine Seele zusprach, ein kleiner Unterschied, der ihn über den Rest der Natur erheben sollte: »Cogito, ergo sum« -»ich denke, also bin ich« -als Qualitätsmerkmal in einer Welt voller Maschinen? Auch der schwedische Biologe Carl von Linne (1707 bis 1778), der die Grundlage des heute gültigen Klassifizierungssystems für Pflanzen und Tiere schuf, hielt an der Sonderstellung des Menschen fest, als er den Menschen zusammen mit den Affen in die zoologische Ordnung der Primaten einstufte: Für ihn bedeutete dies nicht, dass Affe und Mensch miteinander verwandt sind, da zu jener Zeit alle Lebewesen als einzeln von Gott erschaffene Geschöpfe betrachtet wurden.
Dabei lag die Idee von einer langsamen Weiterentwicklung der Lebewesen, von einer Evolution, in der Luft. Es war der Schweizer Dichter Albrecht von Haller, der im Jahr 1744 den Begriff »Evolution« -vom lateinischen evolvere = »entfalten« -prägte, um damit die sogenannte Präformationstheorie zu beschreiben: die (irrige) Vorstellung, dass menschliche Embryos aus von Gott vorgeformten, winzigen Menschlein in Ei- und Samenzelle entstehen.
Der Franzose Jean Baptiste de Lamarck stellte 1809 die erste ernsthafte Evolutionstheorie auf, als er den Wandel von Organismen im Laufe der Zeit von den kleinsten Lebewesen zu den kompliziertesten Pflanzen und Tieren -und damit auch zum Menschen -beschrieb. Seine Theorie basierte auf vier Prinzipien, darunter die Vererbung von »angelernten« Eigenschaften -ein Prinzip, das sich nicht nachweisen ließ. Immerhin hatte der französische Naturforscher erkannt, dass Evolution viel mit Anpassung zu tun haben muß und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ein Zeitgenosse Lamarcks, Charles Darwins Großvater Erasmus Darwin, war schon auf der richtigen Fährte, als er sich fragte, ob nicht die natürliche Auslese die Triebkraft der Evolution sei. Erst Charles Darwin (1809 bis 1882) besaß jedoch genug Intuition und Beobachtungsgabe, Zeit und Zähigkeit, um die in Natur und Bibliotheken verborgenen Fakten in ein sinnvolles System zu ordnen.
Im Jahr 1831 trat er eine fünf jährige Reise rund um die Welt an Bord des britischen Vermessungsschiffs »Beagle« an. Die lange Fahrt verwandelte den jungen Biologen in einen leidenschaftlichen Naturbeobachter. Auf dem abgelegenen Archipel der Galapagos-Inseln, rund 1.000 Kilometer westlich von Ecuador im Pazifik gelegen, machte Darwin während eines vierwöchigen Aufenthaltes eine Entdeckung, die ihn nicht wieder loslassen sollte: Auf jeder Insel lebte eine andere Finkenart, die jeweils eine bestimmte ökologische Nische ausfüllte. Er beobachtete jede einzelne Art sorgfältig und kam zu dem Schluß, dass alle diese Finkenarten nahe miteinander verwandt sein mußten. Nach vielen weiteren Studien kam Darwin 1836 mit der Überzeugung nach England zurück, dass sich Spezies in verschiedene Richtungen entwickeln, wenn sie voneinander isoliert werden. Die Frage war nur: Weshalb?