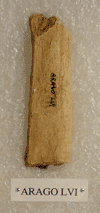Die Schöninger Speere - Homo heidelbergensis
Im Rahmen des Langzeit-Forschungsprojektes ASHB (= Archäologische Schwerpunktuntersuchungen im Helmstedter Braunkohlerevier) unter Leitung von Dr. Hartmut Thieme wurde seit 1983 der Braunkohlentagebau Schöningen bei Helmstedt nach archäologischen und paläoökologischen Gesichtspunkten intensiv untersucht. Bis heute konnte auf einer Fläche von 6 Quadratkilometern eine große Anzahl bis dato unbekannter Fundplätze, darunter Siedlungen und Gräber aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit, dokumentiert werden.
Bis Mitte der 1990er-Jahre wurden im Bereich des Baufeldes Süd in kurzer Folge drei altsteinzeitliche Lagerplätze mit hervorragend konservierten Faunenresten aus dem mittleren Abschnitt des Eiszeitalters entdeckt.
Die eigentliche Weltsensation aber gelang im Herbst 1995! Man entdeckte einen alt-paläolithischen Fundplatz, auf dem sich zusammen mit Steinwerkzeugen und zahlreichen Resten von Großsäugern, hauptsächlich dem Pferd, mehrere hölzerne Wurfspeere aus der Zeit des Homo heidelbergensis erhalten haben. »Die Schöninger Speere ermöglichen uns völlig neue Einblicke in die Entwicklung und Kultur des frühen Menschen vor etwa 400.000 Jahren«, so die Wissenschaftler. Obwohl andere Datierungsansätze von etwa 270.000 Jahren ausgehen (O. Jöris, 2005), können die Schöninger Speere nach wie vor als älteste vollständig erhaltene Jagdwaffen der Gattung Homo gelten und aufgrund ihres Alters Homo heidelbergensis zugeschrieben werden.
Die Wissenschaftler um Hartmut Thieme aus Hannover gruben acht der sehr gut erhaltenen Holzspeere aus den Torfablagerungen eines Seeufers aus. Der in grauer Vorzeit lediglich durch hohes Seggengras bewachsene Uferbereich stellte zusammen mit der aus Nordwesten bzw. Norden kommenden Hauptwindrichtung eine günstige Position dar, in der die urzeitlichen Jäger entsprechend nahe an eine Pferdeherde herankommen und ihr auflauern konnten.
Nur an wenigen Orten in Europa sind die Voraussetzungen zur Entdeckung und Entschlüsselung der Relikte eiszeitlicher Umwelten gegeben. So sind die Schöninger Speere - neben einem etwas älteren Speerfragment aus England - die frühesten Nachweise für Jagdwaffen. An Fundstelle Schöningen 13 II-4 („Speer-Fundstelle“) konnte auf einer bisher mehr als 3.000 qm großen Fläche ein hochkomplexes Jagdgeschehen auf eine ganze Wildpferdeherde nachgewiesen werden. Dies wirft eine Reihe weitergehender Fragen auf, wie z.B. die Jagdbeute zerlegt und weiter genutzt wurde. Wie konnte die große Menge an Frischfleisch nicht nur rasch verarbeitet, sondern auch haltbar gemacht werden? Die Forscher gehen davon aus, dass bereits verschiedenste Konservierungsmöglichkeiten wie Lufttrocknen, Räuchern und Rösten bekannt waren und erwähnen in diesem Zusammenhang ein Artefakt in Form eines hölzernen Bratspießes, mit dem dahingehend trefflich argumentiert werden kann.
Natürlich boten die Tiere auch wertvolle Rohstoffe in Form der Häute, der Langknochen, der Sehnen usw. Was alles verwertet wurde, wird wohl erst nach der vollkommenen Erforschung der vielen tausend Knochen endgültig beantwortet werden können. Aufgrund der relativen Ufernähe der Feuerstellen wie auch der demographischen Verteilung der Pferdereste scheint ein Zeitraum für die Jagd vom Spätsommer bis in den Herbst in Betracht zu kommen. Die Anwesenheit der Menschen darüber hinaus (vielleicht bis in den Spätwinter) bewirkte wohl, dass fast kein Raubtierverbiss an den Knochen festzustellen ist.
Die Speere sind - bis auf einen - aus jungen Fichtenbäumen gefertigt. Nur einer ist aus Kiefernholz. Die Auswahl des Holzes ist wohl in erster Linie klimatisch bedingt, da Nadelhölzer angesichts des um einige Grad Celsius kühleren Klimas reichlich zur Verfügung standen - und zudem leicht verarbeitet werden konnten. Die meisten Speere sind über zwei Meter lang und bis zu 6 cm im Durchmesser. Der Schwerpunkt liegt an der Stelle mit der größten Dicke und befindet sich nahe bei der Spitze. Im Experiment stellten die Wissenschaftler fest, dass die Spitzen beim Trocknen sehr fest wurden und gewiss in der Lage waren, so manchen Dickhäuter zu durchbohren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden diese Speere geworfen, doch konnten sie auch als Stoßlanzen benutzt werden.
Bei Tests konnten Sportler originalgetreue Nachbauten bis zu siebzig Meter weit werfen. Leider sind die Schöninger Speere bis heute noch nicht abschließend analysiert, konserviert und publiziert, so dass genauere Angaben zu den Fundumständen, dem Erhaltungszustand sowie zur Herstellungs- und Benutzungsweise fehlen.
Die Speere belegen zweifelsfrei, dass die frühen Menschen Europas keineswegs Aasverwerter, sondern spezialisierte Großwildjäger waren. Bei den Beutetieren handelt es sich vor allem um Wildpferd, Wisent, Rothirsch und Wildesel. Allein die Gruppe, die die Speere hinterließ, hat wohl 20 Wildpferde bei ihrer Jagdunternehmung erbeutet. Gingen bis vor einigen Jahren selbst hoch angesehene Paläoanthropologen noch davon aus, dass sich Homo erectus bzw. Homo heidelbergensis von Aas ernährt hätten, lassen die Schöninger Speere keine Zweifel an den jägerischen Fähigkeiten dieser Urmenschen aufkommen. Der Speerfund hat das Bild des europäischen Urmenschen radikal verändert und viele, festsitzende Lehrmeinungen ins Wanken gebracht. Die Hersteller der Speere - die etwa vier Mal so alt wie die Neandertaler sind - konnten laut Thieme nicht nur die Waffen bauen, sondern mussten für die Organisation der Jagd auch in einer Form von Sprache miteinander kommuniziert haben.
In den kommenden Jahren soll der akut von Austrocknung bedrohte Fundplatz unter Beteiligung zahlreicher europäischer Naturwissenschaftler weiter ausgegraben und interdisziplinär ausgewertet werden. Die Stadt Schöningen und der Förderverein Schöninger Speere – Erbe der Menschheit e. V. bemühten sich über viele Jahre um die touristische Erschließung des weltbedeutenden Fundortes in einem Forschungs- und Erlebniscenter am historischen Ort. Am 4. Februar 2009 berichtete die Zeitung Braunschweiger Land, dass die Fördermittel genehmigt sind und die Eröffnung des Forschungszentrums für Anfang 2011 geplant ist.
Literatur
Hartmut Thieme (Hrsg.): Die Schöninger Speere. Mensch und Jagd vor 400.000 Jahren. Theiss; Auflage: 1., Aufl. (29. November 2007)