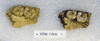Ceprano »Argil« - Homo heidelbergensis
| FUND | FUNDORT | ALTER | ENTDECKER | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| adultes Cranium | Ceprano, Italien | 800.000-900.000 Jahre | Italo Bidutto | 1994 |
| VERÖFFENTLICHUNG | ||||
| Manzi, G.; Mallegni, F.; Ascenzi, A. A cranium for the earliest Europeans: Phylogenetic position of the hominid from Ceprano, Italy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 August 14; 98(17): 10011-10016. DOI: 10.1073/pnas.151259998 | ||||
Die ältesten Anzeichen für die Anwesenheit früher Menschen in Mitteleuropa werden derzeit durch die zahlreichen Funde aus Atapuerca, Spanien, und den teilweise erhaltenen Schädel eines erwachsenen Individuums aus Ceprano, Italien, repräsentiert. Das Alter des Ceprano-Fundes wird aufgrund absoluter (Kalium-Argon) und biostratigraphischer Datierungen auf 800.000 bis 900.000 Jahre geschätzt.
Am 13. März 1994 wurde bei Aushubarbeiten für eine Landstraße nahe Ceprano, einer Stadt in der mittelitalienischen Region Latium (it: Lazio), ungefähr 100 km südöstlich von Rom, ein zersplittertes, unvollständiges und in hohem Maß fossilisiertes menschliches Schädeldach (Calvarium) in situ entdeckt. Die Überreste stammen aus einer Lehmschicht unterhalb einer sandigen Schicht aus Vulkankies. Die Form sowie die Kapazität des Calvariums (ca. 1185 Kubikzentimeter) deuten auf eine Zugehörigkeit zur Art Homo erectus hin, obwohl nicht die gesamte Palette der Eigenschaften eines Homo erectus für Ceprano zutreffend ist. Der Schädel ist auf den ersten Blick wenig spektakulär, er ist nicht einmal vollständig (es handelt sich nur um ein einzelnes Schädeldach), aber vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus ist er zweifellos von enormer Wichtigkeit.
Der Mensch von „Campogrande di Ceprano“ oder einfach „Mensch von Ceprano“ wurde von seinem Entdecker, dem Archäologen Italo Bidutto auf den Namen „Argil“ getauft, was soviel wie Töpfererde bedeutet, da das Fossil in einer Lehmschicht gefunden wurde. Der Mensch von Ceprano ist der älteste Europäer, den man bis heute kennt, älter noch als die berühmten Fossilien aus Atapuerca, Spanien, sieht man einmal von den Funden aus dem Kaukasus (Dmanisi) ab. Die Rekonstruktion wurde in mühevoller Kleinarbeit von dem italienischen Anatomen Antonio Ascenzi durchgeführt.
Der Fund von Ceprano wird in der Presse nur spärlich erwähnt, außerhalb der wissenschaftlichen Fachliteratur bekommt man kaum etwas über ihn zu hören, obwohl „Argil“ etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Denn: Nach der abgeschlossenen Rekonstruktion des Calvariums sind die Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass Ceprano eine einzigartige morphologische Brücke zwischen den älteren Arten Homo ergaster/erectus und der jüngeren, aus dem mittleren Pleistozän bekannten Art Homo heidelbergensis darstellt. Somit würde Ceprano in einem direkten Verwandtschaftsverhältnis mit dem modernen Menschen, mit Homo sapiens, stehen. Betrachtet man die geographischen, chronologischen und phylogenetischen Aspekte von Ceprano, so kann man den Wissenschaftlern zufolge eine direkte Beziehung zu Homo antecessor aus Atapuerca, Spanien, in Erwägung ziehen, obwohl der Fund Atapuerca-TD6 nicht direkt mit Ceprano vergleichbar ist.
Die Anwesenheit von Menschen in Europa jenseits der 500.000-Jahre-Marke ist aus verschiedenen Ecken des europäischen Kontinents eindrucksvoll nachgewiesen worden. Beispiele hierfür sind Fundorte wie Le Vallonet in Frankreich, Monte Poggiolo in Italien und das Guadix-Baza Becken in Spanien. Auch die weit über Europa verstreuten Fundorte der Acheuléen Werkzeugkultur mit einem Alter von mindestens 600.000 Jahren sprechen eine eindeutige Sprache. Menschliche Überreste aus dieser Zeitspanne sind ebenfalls gut erforscht, Beispiele hierfür sind Mauer, Arago, Bilzingsleben, Vértesszöllos und Visogliano für Europa und Exemplare wie Bodo und Kabwe für Afrika. Die europäischen und afrikanischen Funde werden im Allgemeinen der Art Homo heidelbergensis zugeordnet. Die Funde aus Asien der gleichen Zeitspanne werden mehrheitlich als Repräsentanten der der Art Homo erectus angesehen.
Aber zu welcher Art aber gehört nun der Schädel aus Ceprano?
Die Wissenschaftler gehen derzeit aufgrund der geographischen und chronologischen Gegebenheiten davon aus, dass der Fund aus der Gran Dolina (Niveau TD6) aus Atapuerca, Spanien, die beste Vergleichsmöglichkeit bietet. Ceprano ist demnach als eine frühe Form des Homo heidelbergensis anzusehen.
Literatur
Manzi, G.; Mallegni, F.; Ascenzi, A. "A cranium for the earliest Europeans: Phylogenetic position of the hominid from Ceprano, Italy". Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 August 14; 98(17): 10011-10016. DOI: 10.1073/pnas.151259998
F. Mallegni, E. Carnieri, M. Bisconti, G. Tartarelli, S. Ricci, I. Biddittu, A. Segre: Homo cepranensis sp. nov. and the evolution of African-European Middle Pleistocene hominids. In: Comptes Rendus Palevol, Band 2 (2), März 2003, S. 153–159, DOI:10.1016/S1631-0683(03)00015-0