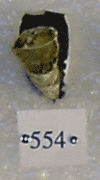Werkzeugkultur - Australien und die neue Welt
Australien, Neu-Guinea und die Neue Welt
Im Verlauf des Pleistozäns breitete sich die Menschheit über die gesamte Alte Welt aus - doch das Ende der Expansion war noch lange nicht erreicht. Am Ende dieser Epoche brachen Menschen auf, um neue Kontinente zu besiedeln. In den neu besetzten Regionen befinden sich einige Fundstellen, die zum Verständnis der Evolution menschlicher Technik von großer Bedeutung sind.
Während des Pleistozäns waren Australien und Neu-Guinea selbst in Zeiten mit niedrigem Meeresspiegel durch eine mindestens 100 Kilometer breite Wasserstraße vom asiatischen Festland getrennt. Diese Regionen können daher nur von Menschen erreicht worden sein, die den Bootsbau beherrschten. Wann genau die Besiedlung stattfand liegt im Dunkeln, doch Forschungen in Nordaustralien lassen vermuten, dass dieses Ereignis vor mindestens 50.000 Jahren stattfand. Das dichte Vorkommen von 20.000 bis 30.000 Jahre alten Fundstellen im Süden des Kontinents scheint diese Schätzung zu bestätigen.
Die ältesten Steinwerkzeuge gehören zur australischen Kern- und Schabertradition. Die Stücke vom Lake Mungo, etwa 30.000 Jahre alt, sind typisch für diese Tradition. Fast alle der retuschierten Werkzeuge sind Schaber, entweder steilflankige Formen aus Kernen, oder Schaber aus Abschlägen. Diese Tradition überdauerte auf dem australischen Festland bis vor etwa 6.000 Jahren und in Tasmanien sogar bis in die jüngste Vergangenheit. Auf dem Festland erscheint nach 6.000 Jahren ein neuer Komplex aus Spitzen, Querbeilen und Mikrolithen.
Die Einfachheit der australischen Artefakte ist nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit einer primitiven Kultur. Auch andere späte Werkzeuge auf dem Festland, wie die der Hoabinhien-Kultur Südostasiens, erscheinen ebenfalls recht schwerfällig. Obwohl abgeschlagene Steinwerkzeuge in der Region einfach sind, begann man in Neu Guinea mit dem Polieren von Steinwerkzeugen zu einem früheren Zeitpunkt als irgendwo sonst auf der Welt - außerhalb dieser Region findet man diese Technik erst im Neolithikum mit der Einführung der Landwirtschaft.
Auf dem amerikanischen Doppelkontinent fand man eine große Fülle und Vielfalt von Werkzeugen. Menschen haben die Neue Welt relativ spät erreicht. Wahrscheinlich wanderten sie von Norden über Beringia, einer Landbrücke zwischen Sibirien und Alaska, ein als der Meeresspiegel sehr tief war. Das Datum der ersten Überquerungen ist umstritten, aber die Datierung der Ausgrabungen bei Pedra Furada in Brasilien könnte darauf hindeuten, dass die Wanderungen vor mehr als 30.000 Jahren begannen. Die Industrie an diesem Fundort ist eine frühe Tradition aus unkomplizierten Abschlägen mit Schabern und Kern-Werkzeugen.
Der Zeitraum vor 12.000 bis 10.000 Jahren zeigt reichliche Spuren menschlicher Besiedlung und eine Vielzahl von Werkzeugen. Unverwechselbare, zweiseitig bearbeitete Spitzen dominieren das Bild - beispielsweise die geriffelten Clovis-Spitzen aus der Mitte Nordamerikas und die späteren Folsom-Varietäten. In den Anden scheinen die ersten Spitzen hauptsächlich auf einer Seite bearbeitet worden sein, doch bifaciale Typen folgen bald. Anderswo an so weit voneinander entfernten Fundstellen wie in Brasilien und Kalifornien findet man viel größere Faustkeile, die den Stücken des Acheuléen ähneln aber nicht mehr als ein paar tausend Jahre alt sind. Pfeilspitzen jeglicher Form findet man in den späteren Kulturen, darunter ähneln viele den Stücken aus der Alten Welt. Schleifsteine sind ebenfalls üblich.