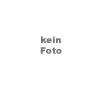Wer hat den größten Grabhügel
Wohlstandsunterschiede innerhalb der oberen Schicht prähistorischer Gesellschaften.
Der Abbau von Ungleichheit zwischen Staaten, aber auch zwischen einzelnen Menschen gehört zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Gleichzeitig ist in jüngster Zeit ein globaler Trend zu beobachten, dass eine kleine Gruppe von Menschen einen immer größeren Anteil am Wohlstand auf sich konzentriert.
Was führt zu sozialer Ungleichheit und welche Auswirkungen kann sie haben? Um solche grundlegenden Fragen zu beantworten, nimmt die Forschung auch die fernere Vergangenheit menschlicher Gesellschaften in den Blick.
Publikation:
Marzian, J., Laabs, J., Müller, J., Requate, T.
Inequality in relational wealth within the upper societal segment: evidence from prehistoric Central Europe
Humanit Soc Sci Commun 11, 557 (2024)
DOI: 10.1057/s41599-024-03053-x
Wirtschaftswissenschaftler und Archäologen haben jetzt im Rahmen des Exzellenzclusters ROOTS an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) den ersten Nachweis für Ungleichheit innerhalb der oberen Gesellschaftsschicht in Mitteleuropa während der ersten 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung geliefert.
„In unserer Studie können wir Wohlstand bis auf die Ebene einzelner prähistorischer Menschen rekonstruieren. Das erlaubt komplett neue Einsichten in die Wohlstandsunterschiede innerhalb des oberen Segments damaliger Gesellschaften“, erklärt Johannes Marzian vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) und Mitglied des Exzellenzclusters ROOTS. Er ist einer der beiden Hauptautoren der Studie, die jetzt in der internationalen Fachzeitschrift Humanities & Social Sciences Communications erschienen ist.
Einzigartiger Datensatz zu prähistorischen Einzelbestattungen
Als Grundlage für die Untersuchungen sammelte das Team Daten von 5000 Einzelbestattungen in Grabhügeln in Mitteleuropa. Als Maß für den Wohlstand der bestatten Personen berechneten die Autoren anschließend das Volumen der Grabügel.
„Damit erfassen wir nicht nur rein materiellen Reichtum, sondern auch die Einbindung in Netzwerke oder den Einfluss einer Person in einer Gemeinschaft. Wer sich einen größeren Grabhügel als sein Nachbar bauen lassen konnte, verfügte offenbar über eine größere wirtschaftliche und politische Fähigkeit, Menschen und Ressourcen zu mobilisieren“, erklärt der zweite Hauptautor Dr. Julian Laabs, der mittlerweile als Junior-Professor für Digitale Archäologie an der Universität Leipzig tätig ist.
Zusätzlich zu den Daten über die Grabhügel flossen Informationen über die Anzahl der in Flach- und Sammelgräbern bestatteten Personen in die Studie ein. Damit berechneten die Autoren, wie groß die Grabhügel-bauende Gesellschaftsschicht im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung war.
Ungleichheit innerhalb der Oberschicht nahm im untersuchten Zeitraum zu
Die anschließende Datenauswertung zeigte, dass über die gesamten untersuchten 4000 Jahre ein hohes Maß an Ungleichheit unter den in Grabhügeln bestatteten Individuen herrschte. Das Ausmaß der Ungleichheit schwankte allerdings. „Diese Veränderungen über die Zeit konnten wir mit bestimmten technologischen Fortschritten, Klima- und Bevölkerungsänderungen oder soziopolitischen Veränderungen in Verbindung bringen“, sagt Julian Laabs. Insgesamt nahm die Ungleichheit innerhalb der untersuchten Gesellschaftsschicht aber zu.
Natürlich erfasst die Studie nicht Ungleichheiten über die gesamte Bandbreite der Gesellschaft. „Aber gerade Ungleichheit und darauf beruhende Spannungen in der oberen Gesellschaftsschicht können sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken“, erläutert Johannes Marzian.
Studie zeigt den Weg zu weiteren Erkenntnissen über Ungleichheit in der Vergangenheit
Mit der Studie geben die Autoren einen ersten Überblick über Ungleichheiten innerhalb oberer Gesellschaftsschichten in prähistorischen Zeiten. „Wir verstehen sie als ersten Schritt und als eine Anregung für weitere Forschungen. Man könnte sowohl den geographischen Rahmen erweitern als auch zeitlich oder räumlich fokussiertere Studien durchführen“, betont Johannes Marzian. Julian Laabs ergänzt: „Schon der Datensatz, den wir für diese Studie erstellt und jetzt veröffentlicht haben, bietet weitere Ansatzmöglichkeiten. Wir laden Kolleginnen und Kollegen ein, ihn dafür zu nutzen. Denn die Forschung zu den Dynamiken von sozialer Ungleichheit muss noch viele Fragen beantworten, wenn wir auch aktuelle Entwicklungen besser verstehen wollen.“
Diese Newsmeldung wurde mit Material Cluster of Excellence ROOTS - Social, Environmental, and Cultural Connectivity in Past Societies via Informationsdienst Wissenschaft erstellt